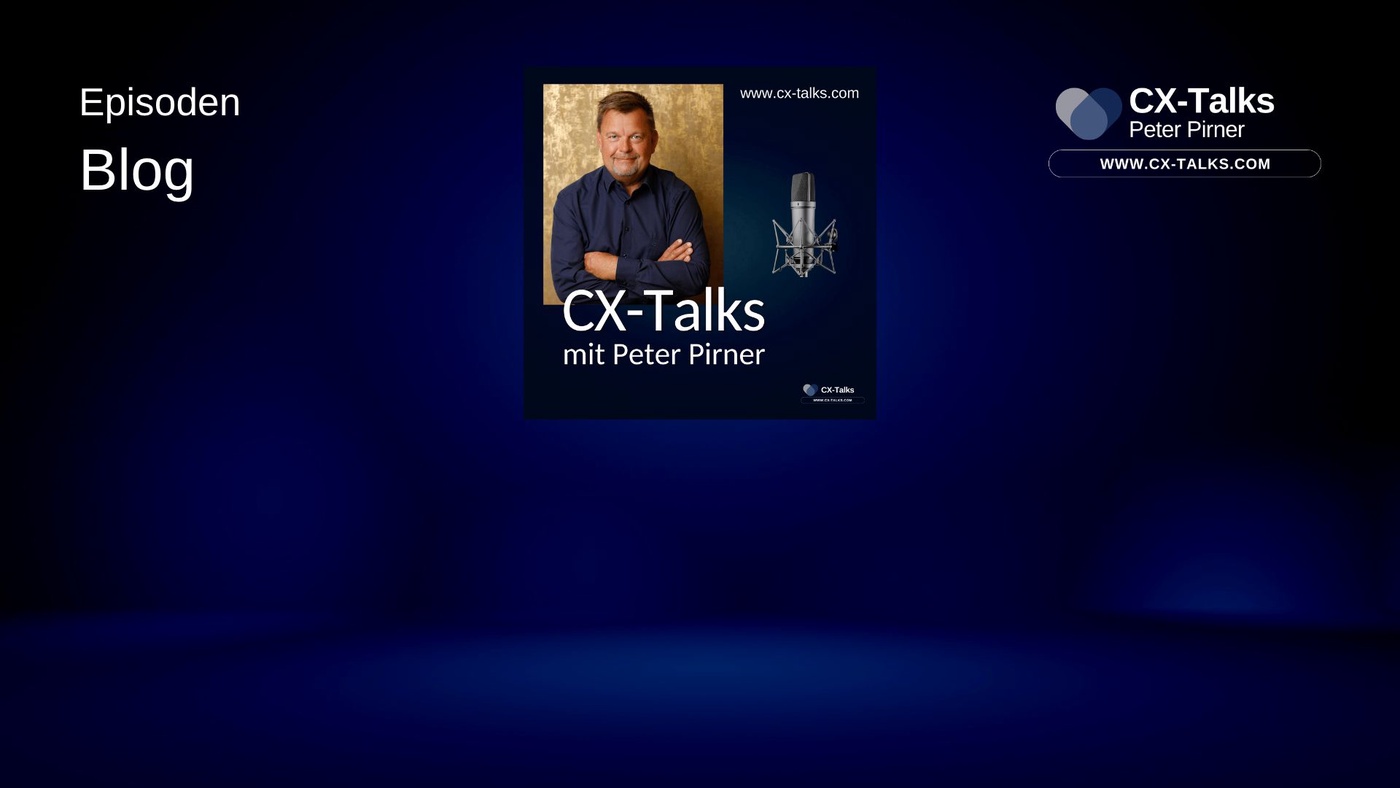
CX-Talks - Insights, Technologie und Management für bessere Customer Experience
Der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für CX Management
Transkript
Speaker 1: In der heutigen Folge geht es die Messung und Analyse der Customer Journey. Wir schauen uns ein Modell von Forester an und beschäftigen uns mit der Frage, welche der vier Perspektiven, die man auf die Customer Journey einnehmen kann, denn nun die wirklich entscheidende ist.
Speaker 1: Herzlich Willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirna und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Unternehmen sind im Moment ganz heiß darauf, die Customer Journey besser zu verstehen und zu optimieren. Geredet wird eigentlich überall davon, im Marketing, im Customer Service und natürlich im CX Management selbst. Deshalb geht es in der heutigen Folge auch bei CX Talks die Customer Journey. Wie sie heute üblicherweise analysiert wird, wie man sie eigentlich analysieren könnte und sollte. Dazu hat mein heutiger Gast Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forester, geforscht. Die Ergebnisse wurden dieses Jahr auf der großen Kundenkonferenz in London vorgestellt und ich fand das Vorgehen erfrischend neu. Einfacher als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Journey den MPS abzufragen, ist es nicht. Dafür hilft die Auseinandersetzung mit dem Messmodell sämtliche Facetten der Customer Journey im Blick zu haben. Entscheiden muss dann jeder selbst, wie er das in sein System einbauen will und kann. Aber zumindest trifft man nach dieser Folge diese Entscheidung informiert. Also lasst uns einsteigen in die Messung der Customer Journey.
Speaker 1: Sie herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, ich freue mich total, dass ich wieder bei dir sein kann. Und ich freue mich erst. Liebe Maxi, die regelmäßigen Hörer von CX Talks kennen dich ja schon und nicht wenige warten ganz begeistert auf die nächste Folge mit dir. Du bist Analystin bei Forrester und zu deinen Aufgaben gehört es sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen im Bereich von CX zu informieren und die Forrester Kunden damit diesen Informationen zu versorgen. Wie informierst du dich normalerweise selbst über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich CX? Also das ist was wahrscheinlich alle machen, sich so anschauen, was von Technologien rauskommt, Briefings von Vendoren, was sie an neuen Dingen machen, planen, aber auch eben viel von selbst von der, der, der quasi von den CX Teams, was sind deren Probleme, deren Herausforderungen, wie interagieren die mit anderen Unternehmen. Also das ist so wie so ein Umfeld, Umwelt-Scanning, was wir da machen. Und das bringt dann manchmal neue Fragen, die man eigentlich beantworten müsste. und die dann wieder zu Forschungsprojekten werden.
Speaker 1: Was sind deine liebsten Quellen? Außer natürlich Forrester selbst. Das kommt total aufs Thema an. gibt einfach in vielen Themen gibt es ganz, ganz tolle, tolle Anbieter, tolle Schreiber. Ich habe jetzt ein Thema, Measurement, die Stacy Barr entdeckt. Die finde ich super toll. Es kommt wirklich immer drauf an. Ich mag gerne Leute, die recht pragmatisch und ohne viel BS-Bingo über Themen schreiben. Das ist zum Beispiel so ein Buch von der Stacy Barr jetzt. Wenn du deine unterschiedlichen Informationen zusammengetragen hast, wie entwickelst du dann tatsächlich neue Konzepte, die ihr dann ja selbst wieder in Artikeln verwendet? Also es gibt ja viel in der Welt, was schon mal gekommen ist. ein Teil von der Arbeit bei Forrest ist eigentlich zu sagen, hier ist ein Konzept, das hat es vielleicht schon mal gegeben, aber hier kannst du dir das anwenden. Zum Beispiel das Thema Wertschöpfung für Kunden. Natürlich gibt es das schon seit 30 Jahren, aber das wird trotzdem im Unternehmen nicht gemacht. Und dann ist es halt sich zu überlegen, warum wird das nicht gemacht? Was gibt es vielleicht schon für Ansätze aus dem Change-Management? Was gibt es für Ansätze aus der Forschung, die man zusammenbringen kann und man versuchen kann, in Päckchen zu schnüren, dass dann Jemandem, der im Unternehmen ist, irgendwie hilft, zu machen, sodass das dann mal auf die Straße kommt, obwohl es vielleicht alterweilig neuen Schleuchen ist. Aber das ist das eine. Und das andere ist, dass es einfach so Themen gibt, wie zum Beispiel vor irgendwie acht Jahren habe ich mal ein Report geschrieben über die AI Revolution in CX Measurement. Und dass es halt dann einfach sich selber zu überlegen, wie kann man so ein Thema strukturieren, dass es rüberkommt, dass man das auch bisschen einfacher erklärt. Zwei Arten von Use Cases, hier sind ein paar Beispiele. Es ist halt immer sehr...
Speaker 2: Also die Forschung, die die die Vorreister machen, ist ja immer sehr anwendungsorientiert, praxisnah und die meisten meiner Forschung, meiner Reports fangen irgendwie an mit How-To. Weil ich das eigentlich interessant finde. Wie kann man Leute dabei helfen, dass sie irgendwas machen, was sie wissen, dass sie machen sollen vielleicht? Manchmal wissen sie es nicht, manchmal wissen sie es schon, aber sie machen nicht. Ihr habt ja auch Anlässe, ihr dann eure Forschungsarbeit vorstellt. Eine unserer Anlässe ist zum Beispiel eure große internationale Konferenz, wo ich dieses Jahr mit dabei sein durfte. Und da hat mich tatsächlich ein Konzept von euch sehr beeindruckt, über das wir heute reden, nämlich das Konzept zur Messung der Customer Journey. Und einen soften Einstieg in das Thema zu bekommen, würde ich dich jetzt mal bitten, was definiert denn eine Customer Journey. gehört dazu? Wie würdest du das beschreiben? Auch in deinem Konzept? Wie hast du das da beschrieben? Ich hoffe, die Leute nicht wieder aufhören zuzuhören, weil wir jetzt über Definitionen sprechen. Peter fragt das aus einem bestimmten Grund, und zwar ist das Wort Journey ja komplett überbenutzt und ausgenudelt. Jeder Benutz ist ein bisschen anders. Wir versuchen bei Forester, meine Kollegin Joanna, kennt Anila und ich, uns stark auf das Thema zu konzentrieren, dass eine Journey ist eigentlich der Weg eines Kunden und auch die Wahrnehmung lang des Weges auf... den Weg zum Ziel, also der Weg des Kunden zum Ziel und die Wahrnehmungen entlang dieses Weges. Und da ist eben wichtig dieses Thema Ziel des Kunden. Das geht so in die Richtung Jobs to be done, können große oder kleine Jobs sein, aber es muss immer ein Kundenziel sein. Und der Weg, eine Journey geht, das ist auch nicht nur die Interaktion mit dem Unternehmen. Es ist ja manchmal, dass eine Journey definiert wird als die Interaktion mit dem Unternehmen. Aber natürlich macht ein Kunde auch andere Sachen. Die sprechen mit Freunden, Familien, die sind mit anderen Unternehmen am Arbeiten, die
Speaker 2: Wir müssen vielleicht mal warten auf eine Entscheidung oder mach irgendwas. Also das ist alle Schritte, die der Kunde auf dem Weg zu einem Ziel zurücklegt und was er dabei an Wahrnehmungen hat. Das ist eine Customer Journey. Es unterscheidet sich ja zum Teil bisschen davon, wie manche Unternehmen das selber für sich definieren, weil du eben sagst, es ist eigentlich aus Kundensicht der Weg zur Erreichung eines Ziels. Ich hänge ja doch an diesen Definitionen, weil man auch so oft liest, dass Unternehmen jetzt alle schon irgendwie Journeymapping gemacht haben, ihre Customer Journey kennen. Dann siehst du mal Quellen, wo es heißt, naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das mal gemacht, aber irgendwie haben wir das Gefühl, so richtig hat es uns auch nicht geholfen und wir haben es vielleicht dann doch noch zu sehr aus unserer Perspektive heraus gemacht. Wie siehst du denn den aktuellen Stand der Customer Journey Analyse und Ermessung in den Unternehmen, wenn du jetzt so an die Kunden in der Dachregion denkst? Also vielleicht sechs von zehn Leute, die mir eine Customer Journey präsentieren, sagen die Customer Journey und meinen eigentlich den Life Cycle. Der geht dann bei Awareness los und endet mit Retention oder Advocacy. Und da finde ich eigentlich zwei sehr einfache Tests. Wenn es die Customer Journey ist, die einzige Customer Journey, ist es wahrscheinlich ein Life Cycle, weil ein Kunde nämlich auf ganz vielen Journeys ist, die uns als Unternehmen mit drin haben. Und das zweite ist, wenn man da keinen kein Ich davor setzen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Unternehmensziel, kein Kundenziel. Ich, Retention ist jetzt kein Ziel des Kunden. Ein Lebenszyklus übrigens ist ein sehr, wichtiges Tool, überhaupt keine Frage. Aber der Lebenszyklus ist halt wie so ein Aufhänger für Journeys. An dem hängen dann verschiedene Journeys dran, durch die die Kunden gehen innerhalb des Lebenszyklus. Und ich sage das nicht, wie gesagt, nicht, weil ich die Sprachpolizei bin, das möchte ich gar nicht sein. Aber dieser Schritt runter, dieser Schritt ins mehr Konkrete
Speaker 2: Der hilft uns, damit Journeys messbar zu machen, Journeys zu gestalten und auch Journeys besser zu verstehen. Auch ein Business Case kann man da besser machen. Also das ist ein notwendiger Schritt in diese Konkretisierung zu den Kundenzielen hin. Wenn du sagst, die haben eher so die Lifecycle-Perspektive und das kann ich nur unterstreichen, das geht mir auch sehr oft so, welche KPIs dominieren dann die Analyse? Weil auf einen Lifecycle schaue ich ja auch nochmal anders als auf eine Customer Journey, über das wir dann im Detail nochmal reden wollen, wie wir das besser machen können. Aber welche KPIs dominieren in der Analyse einer Customer Journey jetzt in der Perspektive deiner Gesprächsparte? Meinst für den Lifecycle oder für die? Für den Lifecycle dominiert aus der Customer Experience Perspektive ganz klar der NPS natürlich. Wir sehen aber auch da noch recht viel Marketing Sachen, weil man dann meist auch halt der Lifecycle wird ja auch sehr als Funnel betrachtet, irgendwie wie kriege ich den Kunden von vorn nach hinten? Am besten nicht nach ganz hinten, sondern nur so in die Mitte ungefähr. Und da sind dann auch viele Marketing so Awareness Metriken. für den Life-Sign.
Speaker 2: Und als CX-Metrik wird dann meistens der NPS reingeworfen. Das ist ja auch was, am Ende rückblickend auf die Journey misst. Hast du das Gefühl, dass viele schon intensiv sich mit der Customer Journey Analyse, also mit echten Journey Analytics in einzelnen Prozessschritten beschäftigen oder dann sogar den nächsten Schritt schon geleistet haben hin zur Customer Journey Orchestration? Mein Eindruck ist, dass das relativ viele gerne möchten, aber wenige machen. Wenn wir uns mal die Daten angucken von unseren eigenen Umfragen unter CX Teams, ich sage es jetzt mal ungefähr in der Größenordnung, die Zahlen sind vielleicht nicht ganz richtig, aber sind irgendwie so, um die 50 bis 60 bis 70 Prozent haben irgendwie so ein Customer Feedback Management Tool. Nicht irgend so ein, haben einen Customer Feedback Management Tool und vielleicht irgendwie so 20 bis 30 Prozent machen irgendwas mit Journey Analytics, ein bisschen weniger noch mit Journey Orchestration. Und wenn man dann auf die quasi auf die Investitionen schaut, wo die gemacht werden. Da wird noch verstärkt, dass eben das Customer-Feedback-Management immer noch wichtig ist und Journey halt sehr, viel weniger wichtig ist. Was wir ja schon auch mal bisschen besprochen hatten im Rahmen der letzten Predictions, dass es doch interessant ist, dass in dem Thema, wo es wirklich darum geht, konkrete Kundenreisen zu verbessern, analysieren, verbessern, ist weniger Investitionen als so insgesamt ein Thema Feedback. Wobei natürlich auch diese großen Customer-Feedback-Management-Solutions jetzt ja auch. was wir Journeys mit drin haben. wenn wir so die Use Cases angucken für diese großen Customer Feedback Management Solutions auch, basierend auf diesen Daten, die wir haben, ist das halt auch sehr, sehr, sehr stark noch auf Surveys. Surveys und Dashboards. Nicht so, nicht so stark der Journey-Gedanke.
Speaker 1: Kommen wir zum eigentlichen Thema heute, nämlich wie man die Customer Journey anders messen kann als das die meisten tun. Ihr sprecht davon vor Lenses und wie gesagt, mir hat es so gut gefallen, dass ihr unbedingt eine Sendung draus machen wollt. Also ich bin da jetzt in dem Fall nicht neutral, weil ich den Ansatz wirklich hervorragend und sehr interessant finde. Welche Perspektiven, es ist ja dann eben nicht nur eine oder wie kann man denn auf eine Customer Journey schauen, wenn ich sie analysieren möchte. Was sind da die unterschiedlichen Perspektiven oder die Lenses, die ihr angewendet habt? Also sag ich vielleicht mal ganz kurz, warum wir das überhaupt angeschaut haben. Wir haben überlegt, wie kann ein Unternehmen, stell dir mal vor, du hast so ein Lifecycle. Stell dir mal vor, ein weißes Blatt vor dir, oben malst du den Lifecycle hin und drunter ganz viele Journeys, die in diese Lifecycle-Phase gehören. Jetzt muss ich in Unternehmen ja überlegen, wo fange ich denn an zu optimieren? Wo muss ich denn drauf schauen? Ich hab dann manchmal dieses Bild im Kopf von einem Kleiderschrank, wo ich irgendwie, so einem Schrank an Journeys, wo es ein paar Journeys gibt, die sind total schön und blitzblank und ein paar, sind so bisschen... traurig aus und die traurigen nehme ich dann raus, poliere sie auf, messen ein bisschen, verbessere ein bisschen und tue sie wieder in meinen Schrank rein. Das ist so mein Man-Man-Bild dazu. Und was wir jetzt gesagt haben ist, wie kann denn eigentlich ein Unternehmen verstehen, welche Journeys sie rausnehmen müssen aus dem Schrank und aber auch gleichzeitig was, was sie denn aufpolieren müssen. Und das ist eben diese Idee der Journey-Messung. Und wir haben dann eigentlich mit der Hypothese angefangen, ja, Zielerreichung zum Beispiel ist wichtig, aber gibt es da eigentlich noch andere Dinge. Und sind dann in unserer Forschung jetzt auch quantitativ nachgewiesen darauf gekommen, ja, Zielerreichung ist wichtig, die Kunden wollen natürlich an das Ziel der Journey kommen, aber das macht nur einen Teil des gesamten Bildes aus, dieser gesamten Wahrnehmung, von der ich ja vorhin gesprochen habe. Es gibt dann noch drei andere Dinge, die wichtig sind. Das erste, was, also neben der Zielerreichung, das erste, was vielleicht sofort auch einige dran denken, ist, wie viele Momente sind schlecht und wie viele Momente sind gut. Das ist so diese, wie nennt das, diese Value Ratio.
Speaker 2: Wenn man sich das mal in The Journey vorstellt, also stellt euch mal vor, da ist eine Linie wieder auf ein weißes Blatt, eine waagerechte Linie und dann ist so eine Wellenfigur nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, ne? Oben ist grün, unten ist rot. Wie viel ist grün, wie viel ist rot? Das ist so die Idee dieser Value Ratio. Das dritte ist, wo sind denn die Huggel? Ist es am Ende gut, am Anfang gut? Gibt es Überraschungen? Gibt es ganz starken Abfall plötzlich und dieses Zusammenbisschen, den nennen wir Value Shape? Da geht es also mehr darum, wann sind denn gute Punkte, wie stoßen die aufeinander. Und das letzte, und das ist so ein bisschen eine andere Linse eigentlich, kann man aber darüber sprechen, ist so diese Baseline. Und Baseline ist, wie gehen Kunden in eine Journey rein. Das ist natürlich informiert sehr stark von dem, sie sich über den Brand denken. Also wenn ich schon weiß, dass ich jetzt mit einem Unternehmen zu tun habe, das vielleicht immer zu spät kommt. Sorry, jetzt mal schon wieder, vergiss es. Vergiss das Deutsche Band Bashing, wollen wir nicht machen. Aber wenn du schon weißt, dass es blöd wird, dann gehst du auch ganz anders in so eine Journey rein. Und das zweite ist natürlich die Journey an sich, das Ziel, das du hast. Wenn du zum Beispiel irgendwie Milch kaufst im Supermarkt, da hast du wahrscheinlich keine großen schlechten oder Emotionen. Du gehst einfach rein, du kaufst Milch fertig. Wenn du aber eine Hypothek vielleicht willst für dein Haus, bist du wahrscheinlich ganz schön aufgeregt und ach, wie funktioniert denn das? Und da ist halt diese Baseline eher so Richtung negative Emotionen im Sinne von, Gott, Gott, Gott, würde das denn alles gut gehen? Und diese Baseline wird natürlich beeinflussen, was du entlang der Journey dann auch wahrnimmst, weil das ist dann deine Brille, mit der du reingehst in die Journey. Und da ist es für ein Unternehmen sehr wichtig zu sehen, ob sie von der Baseline irgendwie wegkommen. Entweder bei der Baseline bleiben, wenn sie gut ist oder wegkommen, wenn sie schlecht ist. Also Baseline ist das erste, das zweite war die Value-Shape, dritte Value-Ratio und vierte die Zielerreichung. Das coole ist ja, ihr habt auch noch eine große europäische Consumer Benchmark Studie und da habt ihr diese Perspektiven auch mal getestet. Das heißt, können das jetzt auch noch mal plastischer machen, indem wir die Beispiele aus dieser Studie nehmen, nochmal zu erläutern, was denn da eigentlich so bei rumkommen kann. Ich würde jetzt anfangen, weil du ja am Anfang gesagt hast, letztendlich geht es darum, dass ein Kunde ein Ziel erreicht. Fangen wir doch einfach hinten an. Also mit der Zielerreichung.
Speaker 1: Denn darum geht es ja letztendlich, wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann ist die Baseline auch schon wurscht. Wie habt ihr die Zielerreichung in eurer Consumer Study gemessen und was ist euch da ganz besonders aufgefallen? Ja, wir haben das versucht, von den Kunden herzumessen und sie entscheiden lassen, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Und das auch, muss ich ehrlich sagen, das hat natürlich einen kleinen Nachteil. Und zwar, dass nicht alle Kunden vielleicht wirklich über das langfristige Ziel nachdenken, was sie eigentlich hatten. Das ist ja, wenn man mal über das Thema Zielerreichung nachdenkt im Journey-Bereich, ist ja eigentlich die große Botschaft, die große Botschaft. Bitte denkt nicht nur an das unmittelbare Ziel. Denk an das längerfristige Ziel. Ich möchte keine Hypothek, ich möchte ein Haus kaufen. Ich möchte keine Sportschuh kaufen, ich möchte gerne fitter werden, was auch immer das ist. Und da haben wir aber einfach Kunden gefragt, ob sie ihr Ziel erreicht haben und ob sie noch dabei sind und haben gefunden, dass diese Zielerreichung einen recht großen Einfluss hatte darauf, wie sich Kunden nach der Journey fühlen. Also vielleicht nochmal dazu zum Kontext. Wir haben auch dann Fragen gestellt, wie sie sich selber fühlen, was sie über den über die Marke denken oder die Firma denken, es ist besser oder schlechter geworden, wie loyal sie sein wollen. Und da haben wir gemerkt, die Zielerreichung ist sehr wichtig, aber eben, wir reden so 30 Prozent. Okay. Insgesamt. Nicht 90 Prozent. Was wieder für uns interessant war, weil wir ja eine Hypothese hatten, dass Zielerreichung nicht alles ist. Das heißt, Zielerreichung, vielleicht kann man es doch als Hygienefaktor bezeichnen in gewisser Hinsicht, aber es macht eben nicht alles aus. Was mehr, also was hat sich noch zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, wenn das Ziel nicht erreicht wird, ist die B-Sign auch schon futsch. Können wir also eigentlich so in den Daten nicht finden, sondern wenn das Ziel nicht erreicht wird, heißt das einfach, dass man als Unternehmen quasi was von dem, hm, oder dass man was verliert von dem Kundenwohlwollen.
Speaker 2: Wenn das Kundenwohlwollen aber sehr, groß ist, wenn das ein Unternehmen ist, was ich ganz toll finde, dann kann ich auch ein, zwei Mal vielleicht mein Ziel nicht erreichen. Besonders wenn dann vielleicht noch klar wird, naja, das war ja nicht das Unternehmen, was da schuld war, noch andere Faktoren. Kunden sind ja auch nicht, Schwarz-Weiß, die wissen ja auch, dass nicht das Unternehmen nur was dafür kann, ob sie das Ziel erreichen. Und deswegen ist das halt so quasi wie so ein Wohlwollenskonto, das man hat und das dann mit der Zeit leerer wird. Ihr konkret untersucht, ihr habt untersucht Banken, das weiß ich, und habt ihr, wenn wir bei denen jetzt mal bleiben, bei Banken habt ihr welche Journey untersucht. haben ganze Reihe von Journeys. Wir haben Journeys untersucht im Bereich Neuprodukte, ein neues Bankkonto oder eine Kreditkarte. Wir haben geschaut nach Problemlösungen. Also zum Beispiel hatte ich immer so einen Fraud Case. Was ist das deutsche Wort? Betrug. Dankeschön. was. Und wir haben auch das Thema Accountmanagement, also einfach diese Tätigkeiten, die man immer mal wieder macht, zum Beispiel Geld zu überweisen oder irgendwas zu regeln in seinem Kundenkonto. Jetzt sind ja diese Journeys sachlich begründet, genau gleich, egal bei welcher Bank ich eigentlich bin. Trotzdem gab es sehr, sehr unterschiedliche emotionale Reaktionen bei den Kunden über die untersuchten Banken hinweg. Wie habt ihr das erklärt? Ist eigentlich derselbe Job to be done und trotzdem wird da anders erlebt. Ja, ist ja das, was wir, das ist genau das Problem. Dafür reden wir ja eigentlich schon seit 25 Jahren in Custom Experience, dass am Ende die Emotionen, der Kunde hat, sehr, wichtig sind und sich auch sehr unterscheiden und die Emotionen eben nicht nur daher kommen, ob der Kunde irgendwas erreichen konnte, sondern auch von anderen Faktoren. Und wir haben da so in dem Thema, in dem Thema Treiber gefunden, dass es bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel es geht schnell.
Speaker 2: lustigerweise, einen Rieseneinfluss auf Emotionen gehabt haben. Und wir haben eine ganze Reihe von Treibern getestet. Und was wir auch gefunden haben, ist, dass die Treiber sich unterscheiden zwischen den Industrien. Wir sind jetzt auf Banken fokussiert und ich will jetzt auch dabei bisschen bleiben, weil da haben wir die meisten Detailanalysen gemacht. Aber man sieht also zwischen den Ländern, die wir hatten, das waren England und Frankreich, und das war auch zwischen Industrien im größeren Unterschied. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass auch wenn es die Treiber geht, sehr viel im Thema so Prozess war. Also eine der wichtigsten Treiber für die Banken war, dass Bankkunden war, dass es schnell ist. Und direkt danach kam so was wie, ich weiß, was in jedem Schritt passiert. Ich weiß, also quasi, weiß immer, was als nächstes passieren wird. Das heißt, Leute brauchen, brauchen sehr, sehr stark dieses, dieses Selbstverständnis, dass sie quasi das unter Kontrolle haben. Und Sachen, dann, Treiber, die dann nachkamen, war, dass man Hilfe bekommen kann. Wenn man welche Hilfe braucht, bekommt man Hilfe. Das ist natürlich auch jetzt interessant, dadurch, dass ja viele Unternehmen so versuchen auf so Contact-Deflection mit, na, mach doch mal lieber das Selbstservice und so, ist halt so ein Treiber, ich hab an jedem Punkt Hilfe bekommen, ganz wichtig. Das kann eben noch nicht immer alles nur abgebildet werden durch durch Technologie. Also das waren jetzt mal ein Eindrücke. Es gab auch so zum Thema Mitarbeiter natürlich was, dass die Mitarbeiter alle Fragen beantworten konnten, man welche hatten und dass man auch Kommunikation bekommt proaktiv. Und das waren alles Treiber, in denen sich diese Banken untereinander sehr unterschieden haben, wie gut sie wahrgenommen wurden, was dann trotz Zielerreichung erklärt, dass die generellen Emotionen der Kunden verschieden waren, je nach Bank. Du hast jetzt über Selbstservice gesprochen, du hast über die Mitarbeiter gesprochen. Welche Rolle spielen diese Kanäle denn für die erfolgreiche Zielerreichung bei euch untersuchten Fällen? Weil der Trend geht ja hin bisschen weg von den Personen, solange es einfach ist, hin zur Technologie und nur wenn es wirklich schwierig wird, dann die Unterstützung durch den Menschen.
Speaker 2: Also wir haben auch gemerkt, dass wir in den verschiedenen Kanälen unterschiedliche Ergebnisse hatten. was wir ja auch bei unserer Forrester macht, ist diese CX Index Studie, wo wir sehr stark sehen, dass die digitalen Kanäle es einfach schwerer haben, positive Emotionen hervorzurufen. Und die physischen Kanäle, also in der Interaktion mit Menschen, haben einen Vorteil. zum Beispiel, wenn man mal guckt, wie viele Leute haben denn positive Emotionen, nachdem sie jetzt mit dem Menschen gesprochen haben. Ob das persönlich ist, übrigens, oder im Video-Chat oder so, ist egal. Also Mensch versus Webseite zum Beispiel. Da haben die Menschen irgendwie so 1,2, der Anteil der positiven Emotionen ist 1,2 mal das von dem, was jetzt die Webseite zum Beispiel macht. Oder Chatbot macht. Also da ist schon noch ein großer, vielleicht ein Emotion-Advantage von den Personen. Wir sehen aber, dass dieser Emotion Advantage bei den verschiedenen Banken verschieden groß ist. Das wahrscheinlich daran liegt, einfach manche Banken haben so tolle digitale Tools, dass es da nicht zu sehr negativen Emotionen kommt. Aber wenn man so guckt an diese positive Emotionen, wie zum Beispiel für mich verstanden, das ist eben was, was viel durch Menschen noch kommt. Meine Hypothesis, das wird sich auch nicht großartig ändern. Aber möglicherweise hast du dann irgendwann mal Bots, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, ob das ein Mensch ist oder ob das ein Bot ist. Und ich fühle mich verstanden. Aber das ist Side Note. Die zweite Perspektive, die ihr habt, die nennt ihr Ratio. Also das Verhältnis zwischen positiven und negativen Nutzen, Gewinn bzw. Nutzen, Verlust für den Kunden auf seiner Reise. Das ist jetzt immer noch sehr abstrakt. Was heißt das konkret? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Gibt es mehr grün oder mehr rot? Weil da so eine Wellendienzeichen in die Journey. Und da haben wir vor allen Dingen uns auf diese Treiber-Performance konzentriert. Und was wir gesehen haben, war eigentlich sehr interessant. Das war insgesamt sowieso, dass Kunden insgesamt eigentlich sehr positiv waren. Also ich hatte ja schon gesagt, welche Treiber da wichtig waren. Vorhin hatte ich ein paar paar erwähnt. Und wenn man jetzt mal überlegt so...
Speaker 2: So ein normaler Treiber wie zum Beispiel, die, wenn wir mal gucken in meinen Notizen, was ich gerade finde.
Speaker 2: Das ist was von Banken allerdings aus Frankreich, ich sag's trotzdem mal. Die hatten eine tolle Performance. Ich konnte das richtige Produkt finden. Da war irgendwie fast 60 Prozent positiv. eigentlich in so, wenn man in unsere Daten guckt, das ist recht gut. Aber es war halt kein wichtiger Treiber. Stattdessen, wenn man sich die Utility anguckt, sorry, dass ich mal ein paar andere Industrie mit reinbringe, aber die Daten hab ich jetzt gerade vorliegen. Da war das so, gesagt, ist ein sehr wichtiger Treiber, das die Mitarbeiter nehmen mich ernst, wenn ich mich an die Wende... Energieversorger, Dankeschön. Wenn ich mich an jemanden wende, nimmt mich der Mitarbeiter ernst. Kann man auch verstehen, dass es wichtig ist. Und da waren dann zum Beispiel nur 39 Prozent der Kunden, gesagt haben, ja, das war gut. Und das fand ich sehr interessant, dass die... Ich erzähl dir jetzt den Energieversorger.
Speaker 2: die Bewertung der Kunden auf diesen Treibern sich doch sehr unterschieden hat und dass einige Unternehmen in unwichtigen Treibern gut waren, aber in wichtigen Treibern nicht gut waren. Und da ergibt sich natürlich eine Value Ratio draus, die recht schlecht ist. Auch wenn es insgesamt Kunden eher positiv sind. Also 39 % ist immer noch nicht Null Prozent, aber trotzdem ist es halt im Vergleich recht schlecht. Und die Ratio bildet dann im Prinzip ab, ob jetzt die Summe der positiven Erlebnisse gewichtet mit deren Relevanz für das Journey-Erlebnis noch ein positives Verhältnis darstellt oder ein positives Ergebnis liefert oder nicht. Genau. das kann man auch übrigens, alle diese Linsen kann man natürlich sehr, sehr mathematisch betrachten. Man kann aber auch einfach höheres Ding nehmen und sagen gerne, also wir haben auf wichtigen Treibern scheinbar ganz gut dazustehen. Kann man natürlich auch gewichten und so weiter, aber kann jeder sehen, wie er mit seinen Daten, wie er das machen möchte. Die Treiber selbst sind die in allen Journeys und über alle Industrien gleich, nur nicht in ihrer Ausbildung, wie sie bewertet werden, aber die Treiber selber sind das eigentlich mehr oder weniger immer dieselben Parameter. Nein, wir einiges abgefragt und wenn wir gucken, was dann so als wirklich signifikanten Analyse rauskommt, das dreizehn oder so Treiber von vielleicht um die 25, die wir abgefragt haben. Aber die unterscheiden sich nach Industrie und auch nach Land. Zum Beispiel in Frankreich ist es total wichtig, am allerallerwichtigsten bei Banken, dass die Mitarbeiter Fragen beantworten können. Also die Leute wollen einfach Antworten haben.
Speaker 2: Und das ist bei den englischen Bankkunden nicht wichtig. Es ist noch einer der signifikanten Treiber, aber ist wesentlich weniger wichtig. Das kann daran liegen, dass die in dem einen Fall die Antworten kriegen, im anderen kriegen sie es ja gar nicht. Das ist natürlich beim Treiberanalyse immer die Frage, ob so gerade Sachen, wo die Performance schlecht ist, oft zu treibern. Kann definitiv daran liegen. Aber es gibt auch, wenn man so die Daten anschaut, einfach Unterschiede. Das sieht man ja auch in unserer großen CX-Index-Studie. Die Treiber sind einfach verschieden. Wenn man guckt mal bei Banken, bei deutschen Bankenkunden geht es ganz stark so alles ist schnell und so. Aber bei italienischen Bankenkunden geht es ist ein Mitarbeiter, den ich fragen kann, wenn ich ein Problem habe. Das ist wirklich auch kulturell. doch noch unterschiedlich. Also wir haben jetzt von hinten kommend schon mal geklärt, bin ich da angekommen, wo ich ankommen wollte im richtigen emotionalen Zustand, habe ich unterwegs ein gutes Verhältnis an positiven oder negativen Erfahrungen gehabt und jetzt kommt die dritte Perspektive, die heißt Shape. Und was bedeutet das?
Speaker 2: Das ist ein bisschen die Daniel Kahnemann Perspektive, Peak End Rule. Wir wissen ja aus der Forschung, ich würde sagen, Faust Formel Ende gut alles gut. Ist ein bisschen sehr, sehr vereinfacht, aber das ist ja die Idee da. Und wir haben gemessen, drei Sachen gemessen. Wir haben gemessen, ob Kunden das Gefühl hatten, hey, das war super am Ende. Wir haben einfach gefragt, did this end on a high note? Wir haben gefragt, ob es auch positive Überraschungen gab. Wir haben gefragt, ob es negative Überraschungen gab. Denn Überraschungen sind ja so eine Sache, ne? Die meisten Leute mögen eigentlich gar keine Überraschungen, auch keine Überraschungsparties und Überraschungen sind immer ein Problem. Und aber positive Überraschungen sind in dem Fall natürlich ein gutes Problem. Und haben also diese drei Sachen gemessen, eine kleine Idee zu haben, wo jetzt quasi diese Value, wir nennen die Value Peaks und Value Valleys sind. wo es hoch oder runter geht. Kannst du da vielleicht nochmal Beispiele geben, wie so ein Peak in einer Bank Journey ausschauen könnte? Was waren typische Peaks bei einer Bank Journey? Ich kann mir jetzt wenig Peaks bei dem Ausstellen eines Überweisungsträgers vorstellen. Online sowieso nicht, aber ich meine auch, wenn ich ihn persönlich abgebe, ist das eher negativ, weil ich ja erstmal zahlen muss dafür. Und es ist übrigens auch eine interessante Frage, dass du das fragst. Wenn man erstmal vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück, wenn man mal guckt, gibt es negative Überraschungen, gibt es positive Überraschungen? Da haben viel, viel weniger Kunden gesagt, es gibt negative Überraschungen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Also es ist ja auch wichtig, dass man eben nicht negativ überrascht ist. So 10 bis 20 Prozent der Kunden haben gesagt, es gibt negative Überraschungen, je nach Bank, Industrie und so weiter. sorry, je nach Land und Industrie. Positive Überraschungen waren mehr, das war so um die 30 Prozent rum. Und dann waren aber einige Banken, richtig raus hingen. Zum Beispiel in England gibt es die Starling Bank. Das ist ein ganz interessanter Challenger Bank. Da haben halt 44 Prozent gesagt, gab eine positive Überraschung. Und der Durchschnitt von Banken war so ein Drittel, also 33 Prozent. Das heißt, da gibt es was. Und wir haben jetzt leider von den Kunden natürlich nicht erfahren können, wie sie da positiv überrascht worden sind.
Speaker 2: Wir wissen aber, dass es da Dinge geht, zum Beispiel bei dem Thema, ich gebe mal so etwas wie Hypothek, dass man plötzlich eine Nachricht bekommt, dass es schneller geht oder dass sich jemand mit einem persönlich auseinandersetzt. Da ist ja die AIB zum Beispiel, wo man so eine, wenn man quasi bei der Hypothek machen will, plötzlich ist da so eine ganze Checkliste, hier, hier sind die Schritte, so wird es drauf, so wird das Ganze funktionieren. Und das ist ja schon eine positive Überraschung, dass man von am Anfang an weiß, wie das gehen wird. Also es gibt verschiedene Positive Überraschung, das muss nicht immer der Blumenstrauß sein. Manchmal kann es einfach auch sein, man, gerade bei Kundenreisen, mit sehr viel vielleicht Unsicherheit beginnen, dass man einfach ein bisschen Sicherheit bringt. Und das ist auch schon eine positive Überraschung, weil nämlich das gar nicht so normal ist im Markt. Positive Überraschungen sind ja eigentlich so ein Ausdruck davon, dass man irgendwas macht, was differenziert ist, was noch nicht erwartet wird. Überraschung hängt natürlich sehr stark davon ab, was ich mir eigentlich erwartet habe. Und damit sind wir bei der letzten Perspektive, nämlich der, die ganz am Anfang steht, der sogenannten Baseline. Also das ist im Prinzip der emotionale Zustand des Kunden zu Beginn seiner Reise. Also bei der Challenger Bank sage ich jetzt schauen wir mal, was die können. Habe ich vielleicht relativ wenige Erwartungen. Und bei einer sehr etablierten Bank, wo ich seit 20 Jahren Kunden bin, ich, da kann mich nichts mehr überraschen, das wird so wahrscheinlich wieder laufen, da habe ich auch dieses Unsicherheitsproblem gar nicht so richtig. Habt ihr, wo waren denn große Unterschiede in der Baseline, wenn ihr jetzt die unterschiedlichen Customer Journey Arten euch angeschaut habt, oder gab es große Unterschiede nur bei bestimmten Anlässen, bei bestimmten Produkten? Also man kann klar sagen, dass insgesamt Kunden recht positiv sind. Wenn man sich mal diese drei großen Journeyarten anschaut, bei neues Produkt sind über 80 Prozent, haben sie am Anfang gesagt, ja ich fühle mich positiv. Und das sind so Leute, die positive Emotionen genannt haben. Bei Managing Your Account, also quasi wenn man sein Bankkonto einfach benutzt, ist es sogar 90 Prozent positiv.
Speaker 2: Wenn man ein Problem hat, es nur 60 Prozent. Aber immer noch, immer noch. Selbst bei einer Problemlösungsjourney sind noch 60 Prozent, die eigentlich positiv sind. Das wieder, würde ich sagen, gute Nachrichten. Das sehen wir sowieso insgesamt, dass eigentlich Kunden doch recht positiv sind. Wo wir den wirklichen Unterschied gesehen haben, ist dann innerhalb dieser einzelnen Sachen. Wenn man zum Beispiel mal diese neue Produktjourney nimmt und man vergleicht zum Beispiel, ich öffne ein Bankkonto, das sind 87 Prozent, die sich vorher positiv fühlen. Aber wenn es einen Kredit geht, fühlen sich nur 60 Prozent vorher positiv. Also quasi diese Neuprodukt-Journey-Kredit ist eigentlich von der Emotion, mit der man reingeht, fast wie eine Problemlösungs-Journey. Weil wir wissen, dass es mit sehr viel Unsicherheit behaftet ist, das Thema Kredits. Bisschen wie Auto kaufen, Unsicherheit, wird alles funktionieren. Das fand ich sehr interessant, dass es da zwischen den Journeys doch sehr große Unterschiede gibt. Die schlechteste Journey, wo die meisten Negativenimationen am Anfang waren, tatsächlich, wenn man eben irgendwie Betrug hatte. Eine Kreditkarte wurde komischer verwendet oder eine andere Art von Betrug. Jetzt kann man im Prinzip sagen, eigentlich ist es ja eine Steilvorlage für ein Unternehmen, gerade in diesen etwas mit Unsicherheit behafteten Journeys, dann volle Kanne zu punkten. Und wahrscheinlich gelingt es der einen Bank auch besser als der anderen Bank. Auch in euren Studien gab es ja Unterschiede. ihr euch jetzt mal anschaut, was haben denn diejenigen, die das sehr gut gemacht haben, anders gemacht als die, die bei so einer eher schwierigeren, also mit negativen Emotionen oder mit weniger positiven Emotionen gestarteten Reise, die gehändelt haben.
Speaker 2: Also gibt so einige Sachen. haben da auch den ganzen Report sogar noch darüber über Banken und was sie tun, dass diese Emotionen gut sind. Was mir da als Beispiel ganz besonders im Hinterkopf noch ist, ist eine Bank, die ich total toll finde, die ich vielleicht auch nicht so viele kennen. Das ist die Millennium Bank in Polen. waren vor zwei Jahren schon mal nominiert für den Forester Award, Custom Obsession Award. die sind unheimlich toll da drin. Kunden an die Hand zu nehmen. Die haben schon seit irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren ein Programm, das nennt sich so Plain Language. Da geht es wirklich darum, einfache Art Kunden zu erklären, was als nächstes passieren wird. Und das ist ein Riesentreiber natürlich für den Emotionsgewinn. Also mal ein Beispiel. Ja und das führt natürlich auch dazu, dass dann eine Marke tatsächlich auch sich immer stärker darin ausprägt, dass man eben einfache Lösungen hat, verständliche Lösungen, dass man die Kunden an die Hand nimmt. Also insofern ist natürlich so eine Baseline wahrscheinlich schon auch in einem starken Maß davon bestimmt, mit welcher Markenvorstellung ich da reingehe und das wiederum ist bestimmt, wie gut ich das, was ich sowieso dann an Touchpoints leiste, auch kommuniziere und nach außen trage. Ja, auf jeden Fall. Also die Marke spielt eine Riesenrolle. Meine vorherigen Erfahrungen insgesamt als Kunde natürlich, aber auch die Journey an sich. Und, das muss ich auch sagen, es gibt einfach auch verschiedene Typen von Leuten. Manche sind immer cool as a cucumber, andere nicht. Aber ich denke, ist auch gerade so das Verständnis, das wir noch bekommen müssen, dass eine Journey nicht isoliert zu betrachten ist, sondern alle anderen Journeys, durch die ein Kunde schon gegangen ist mit uns. haben eben jetzt entweder auf das Wohlwollenkonto eingezahlt oder nicht. Das dann, die Marke, wie du das so schön sagst, finde Wohlwollenkonto irgendwie so schön als Bild im Kopf. Und das zusammen mit der Person, die es geht und das zusammen mit dem Anlass, diese neue Journey hat, beeinflusst halt diese Emotionen. Aber was wir auch gesehen haben ist, das klingt alles recht kompliziert. Wir haben einfach, wenn man sich das mal so überlegt, was ist jetzt eigentlich die B-Seite? Muss ich das bei jedem Kunden messen?
Speaker 2: Wie finde ich denn das raus? Gott, Maxi, ist ja tausend Faktoren, zu viel. Wir haben bei Forester so eine leichte Vereinfachung, wo man sagt, was ist denn eigentlich die Komplexität? Einer Journey wird es als komplex empfunden, was vor mir liegt. Eben, Kredit, viel komplexer als Milch kaufen. Und wie ist es denn so für mich als Intensität in meinem Leben? Und da ist die Hypothek sowohl komplex als auch intensiv für mich sehr wichtig. von Emotionen her und Milch kaufen ist halt nicht komplex und auch wahrscheinlich nicht sehr emotional intensiv. Und so kann man auch versuchen, die verschiedenen Journeys, die man hat, so ein bisschen in so ein Raster zu bringen, sodass man ungefähr eine Vorstellung hat, was so ein Durchschnittskunde an wahrscheinlich mitbringt in die Journey. Denn dann kann man schon mal anfangen zu sagen, okay, das sind Journeys, example, da weiß ich das zum Beispiel, da weiß ich, dass Leute einfach mit vielen, mit mulmigen Gefühlen reingehen. Da muss ich also recht schnell das Gestalten, dass sich das ändert, aber auch messen, ob ich von dem mulmigen Gefühl wegkomme. Während bei der anderen Journey, da geh ich nicht mehr mulmigen Gefühl rein, da muss ich mich wahrscheinlich nicht so darauf konzentrieren, was jetzt am Anfang passiert. Ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr sehr praktisch und sehr pragmatisch seid. Dann machen wir jetzt, werden wir jetzt nochmal ganz praktischer. Jetzt arbeiten wir uns an eurem Konzept in der Praxis ab. Ich kann ja nicht alle meine Journeys messen und ich kann auch nicht alle Indikatoren messen. Das wird einfach von der Menge her nicht funktionieren. Du hast jetzt gerade beschrieben, das sind die Journeys, wo ich auf jeden Fall mal hinschauen sollte. Wenn ich hinschaue, bei welchen Indikatoren sollte ich zuerst immer mal hinschauen? mich zu orientieren. Ist es die Baseline, ist es die Zielerreichung, ist es die Ratio?
Speaker 2: Antwort, da müssen wir uns noch überlegen. wir sind auch noch ein bisschen dabei, das ganz genau rauszufinden und zu überlegen, was am besten ist. Die erste Antwort ist, man kann sich schon mal angucken, wo wird das Ziel nicht erreicht. Und zwar auch aus dem Grund, weil ja wenn der Kunde sein Ziel nicht erreicht, oft auch das Unternehmen sein Ziel nicht erreicht für die Journey. Das heißt, da ist auch ein ganz konkreter Einfluss auf Geschäftsgrößen. Wenn der Kunde die Hypothek nicht abschließen kann, hat das Unternehmen auch keinen neuen Kunden für die Hypothek. Wenn der Kunde sein Bankkunde nicht öffnen kann und so weiter. Das heißt, deswegen ist die Zielerreichung Vielleicht aus Kundenperspektive, aus der emotionalen Perspektive nicht das A und O, aber das ist halt der Teil, auch wichtig ist. wenn man sich jetzt die Zielerreichung anschaut und dann immer noch viele Journeys übrig sind, dann muss man sich überlegen, was guckt man als nächstes? Und da empfehlen wir eigentlich als nächstes, ein bisschen dieses Verhältnis von schlechten, guten Punkten anzugucken. Und zwar besonders, ob es irgendwie sehr, sehr, sehr starke Probleme gibt, die halt einfach sehr, sehr reinhauen. Also sehr viel Rot oder sehr viel Grün an einer Stelle. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, nichts, was die Zuhörer überraschen wird. Wir gucken nach Pain Points, aber wir gucken eben auch vielleicht nach Sachen, die wir weiterhin so machen wollen, guten Dingen. Also die Zielerreichung, dann die Pain Points. Aber auch wieder da. Und bitte jetzt nicht sagen, hey, wir haben eine Journey, da gibt es ganz viel Friktion und da ist dann der NPS geringer oder so am Ende. Das interessiert keinen Menschen. Also es interessiert natürlich schon, aber nicht... sondern... Hier ist eine Journey und da haben wir ein Problem und wisst ihr, dass unsere Mitarbeiter da auch total viel Zeit verbringen? Zum Beispiel das Thema Kredit oder Hypothek, wenn halt die Kunden ihre Dokumente einreichen, die sie einreichen müssen, so Gehaltsnachweis und so ein Zeug. Und da ist aber was vergessen, müssen die Kunden nochmal einen extra Schritt machen. Und da könnte man sagen, die Kunden müssen nochmal einen extra Schritt machen, noch ein Dokument einreichen. ist ja wirklich diese Friktion schrecklich. Interessiert aber keinen. Weil man gleichzeitig sagt, ja unser Underwriting-Team ist komplett, also die Kreditvergabe und so. die sind komplett unter Wasser und müssen dann alles sich nochmal neu angucken, dann ist das ja was ganz anderes. Das heißt eigentlich, was ich vielleicht sogar als Botschaft rüberbringen möchte, ist, sich diese vier Linsen anzuschauen, angefangen mit der Zielerreichung und mit dieser Miser Ratio, aber sowohl für Kunden als auch für das Unternehmen.
Speaker 1: Und mein Gefühl ist, dass die Baseline, wenn ich ein gutes Gefühl habe, mit welcher Baseline der Durchschnitt meiner Kunden in solche Journeys startet, dann muss ich das nicht kontinuierlich drecken, sondern ich habe einmal so einen Referenzwert, wo ich dann meine Journeys danach zunächst mal auch einordnen kann. Genau, 100 % die baseline ist vor allen Dingen dafür interessant für das Gestalten der Journey und dafür, ob man am Anfang der Journey Metriken einsetzen muss, um zu verstehen, ob man der baseline runtergekommen ist oder von ihr hochgekommen ist, je nachdem. Also das ist eigentlich das Recht, das ist das, wo wir vor allen Dingen gucken, wo wir der baseline und natürlich kann man die baseline auch dazu benutzen, die Journey sich verbessert hat. Man kennt das ja aus Gesprächen, wenn das Gespräch schlecht anfängt, aber gut endet, dann ist es trotzdem okay. Ich habe vorhin gesagt, Ende gut, alles gut. positive Entwicklung gibt, dann ist das sicher sehr hilfreich. Das heißt, wenn man eine Vorstellung hat, wo die Baseline ist, muss man die trotzdem nicht die ganze Zeit messen. Man kann ja am Ende messen, wie die Kunden sich fühlen und dann sehen, es ist positiv, obwohl sie wahrscheinlich negativ hingegangen sind. Wir haben jetzt viel über Messen gesprochen und wir beide sind eigentlich große Vertreter dafür, dass man sich auch zu Tode analysieren kann und dass man Himmels willen aufpassen muss, wenn es einmal aufhört zu analysieren. Man braucht zwar Grundlagen, aber man muss dann auch sehr schnell eigentlich ins Tun kommen und vor allem in die konkrete Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Was gibt es für einen Trick, damit du als CX-Manager dich da immer wieder praktisch zur Ordnung rufst und dich selber diszipliniert, dass du dich nicht zur Tode analysiert. Wie gehst du damit
Speaker 2: Also ich selber bin ein zu Tode Analysierer. Ich leide da auch ganz stark unter dem selber meiner eigenen Arbeit. wenn ich jetzt mit Kunden zusammen arbeite, habe ich irgendwie eine ganz lustige kleine Sache. Wenn du plötzlich merkst, dass der nächste Schritt irgendwie eine fehlwirkige Analyse ist oder irgendwie fühlt sich mega kompliziert an, dann machst du es wahrscheinlich zu kompliziert. Dann ruf mich an und ich bin dein Simplicity-Buddy. Und ich versuche dir zu helfen, wie du das einfacher machen kannst. Denn zum Beispiel kann man ja eine Journey, es ist so das Thema, man kann ja sagen, ich möchte gerne die verbessern, ich kann die ganz, ganz im Detail mappen für alle Kundentypen und so weiter und so weiter, dann die Pain Points rauszufinden. Wahrscheinlich sind diese Pain Points aber auch schon vorher irgendwie bisschen klar. Also dieses immer wieder sich zurückzunehmen, nicht zu sehr in das Detail zu gehen. Das Ding ist komisch, aber nicht zu sehr in das Detail zu gehen ist wichtig. Aber man muss trotzdem die Zeit sich nehmen. und diese Metriken gut gestalten. Also nicht einfach irgendwelche Metriken nehmen. Zum Beispiel nur weil jetzt jeder ein NPS misst, heißt das nicht, dass man für die Journeys auch immer ein NPS messen muss. Sondern wenn das Ziel der Journey ist, dass der Kunde ein Konto eröffnet und sich gut fühlt, dass er bei dir als Bank ist, das war eine gute Entscheidung, dann kann man eben versuchen auch das zu messen. Und das ist so was, wo ich noch sagen möchte, also quasi die Zeit. die man darin investiert, Metriken sinnvoll und auch so spezifisch zu definieren, ist keine verlorene Zeit. Aber alles im Detail, immer versuchen zu beschreiben, zu machen, ist wahrscheinlich, geht dann zu weit. Ich fand dieses Konzept großartig, weil es auch an vielen Stellen einem nochmal neue Ideen gibt darüber, wie man eigentlich drauf schauen kann und man kann eben auch nicht nur mit einer Perspektive drauf schauen, das ist ganz entscheidend. Das haben wir, glaube ich, auch versucht darzustellen.
Speaker 2: Wer es bis jetzt geschafft hat, hier kommt die eigentliche Formel, wie man Journeys misst. Und das ist, dass man für die Journey bestimmt ganz spezifisch, ganz spezifisch, was ist der Erfolg für das Unternehmen und für den Kunden von der Journey? Für den Kunden zum Beispiel, ich habe ein Konto eröffnet und kann das jetzt benutzen und zwar einfach für das Unternehmen. der Kunde hat ein Konto eröffnet, benutzt das jetzt und hat nicht tausendmal angerufen und es total viel gekostet. Super. Also cheap, cheap, cheap sale, die Akquisekosten. Das ist Erfolg. Den muss man dann durch gute Metriken messbar machen. Klare Metriken. geht das spezifisch das messen? Und dann kann man sich überlegen, wo in der Journey wird denn der Erfolg wahrscheinlich am meisten beeinflusst? Zum Beispiel, wenn ich schon weiß, dass Kunden sich am Anfang nicht genau entscheiden können, welches Kontoprodukt zum Beispiel nehmen sollen, dann rufen sie mich an. Ach, kostet schon wieder was. Dann weiß man also genau, es gibt so diese neuralgischen Punkte in der Journey, die am Ende die Erfolgsfaktoren auf einem Dokum. Dafür macht man eine Signalmetrik und dann hat man eine erfolgsmetriken Signalmetriken und so misst man jeder Journey. Die Linsenbetrachtung fließt ein, aber am Endeffekt bleibt es bei Signal- und Erfolgsmetriken für die Journeys. Wunderbares Schlusswort. Liebe Maxi, ganz herzlichen Dank und ich werde dich weiter als mein Vereinfachungs-Buddy nutzen. Die dir auch gerne zur Verfügung. Danke Maxi. Danke schön.
Speaker 1: Das war Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forester zur optimalen Analyse der Customer Journey. Wenn dir die Sendung gefallen hat, leite den Link dazu doch an jemanden weiter, der sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Und damit sind wir am Ende angelangt. Falls du es noch nicht getan hast, lass doch ein Like auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das erleichtert auch neuen Hörern die Orientierung im Podcast-Dschungel. Und sei auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen Themen Management, Technologie und Insights rund das CX-Management beschäftigen. Ich freue mich auf Dich. Bis dahin, bleibt gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen.
Speaker 1: Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des E-Zam auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.